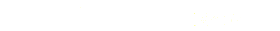VITA
Zum 90.
NACHRUFE
VIDEOS
Anlässlich seines 90. Geburtstags verfasste Reinhold Petermann eine Rede über sein Leben als Künstler. Lesen Sie im Folgenden die Abschrift dieser Rede.
Landläufig betrachtet bin ich ja wohl ein Künstler, aber den Begriff mochte ich eigentlich nie. Ich halte den für aufgesetzt und übertrieben und vor allen Dingen auch für zu überheblich. Also, ich sehe mich noch immer als Bub vom Land, der in seiner ganzen Freizeit Objekte, die ihn interessierten, in Holz schnitzte. Und eines Tages war es dann der weibliche Körper, und der ist mir eigentlich auch ganz gut gelungen. Ich hatte sehr viel Spaß dabei und habe jede freie Zeit genutzt, um zu schnitzen, zu zeichnen oder zu malen.
Allerdings einen Beruf daraus zu machen, wäre mir nicht in den Sinn gekommen, das war völlig absurd – aber der Krieg hat alles verändert.
Am Ende des Krieges kam ich ziemlich verwundet in englische Gefangenschaft, und als ich wieder einigermaßen zurechtgeflickt war, brachte man mich in ein Genesungslager in Edinburgh. Das war eine ganz neue Welt, denn da gab es alles, eben auch Konzerte und Theater. Für ein Theaterspiel brauchten sie so ein großes Bühnenschachspiel und es wurde ein Bildhauer gesucht. Da habe ich dreist behauptet, ich wäre einer. Ich bekam dann einen Raum mit Material und Werkzeug, habe mir Gipsblöcke gegossen und daraus das Schachspiel geschnitten. Das klappte eigentlich ganz gut. Und später brauchte man eine Weihnachtskrippe, natürlich sollte es eine aus Holz sein. Ich bekam ein wunderbares Holzbildhauerbesteck aus Sheffield-Stahl und entsprechende Holzstücke, und dann war ich dort der Bildhauer und wurde durch ganz Edinburgh gereicht. Ich habe für verschiedene Privatleute Objekte gestaltet – ein wunderschönes Leben, es war sorgenfrei, ich wurde gut verpflegt… ja, es ging mir gut.
Als ich genesen war, kam ich in ein normales Gefangenenlager. Ich war bereits avisiert und bekam in der Tischlerbaracke einen Platz, wo ich Holzbildhauern konnte. Ich bin dann jeden Morgen dahin, so wie man auch zur Arbeit geht, und habe, muss ich schon sagen, ich habe gemacht, was mir gerade in den Sinn kam.
Das Lager war unglaublich vielseitig, es gab Künstlergruppen, die malten oder Theater machten. Harald Kreuzberg, der Tänzer, was bei uns. Es wurden auch öffentliche Konzerte veranstaltet, zu denen die Zivilbevölkerung eingeladen war. An einem Theaterstück hab ich sogar selbst mitgewirkt, da war ich prima ballerina, so mit Röckchen – ich war damals noch ein gut aussehender junger Mann, also es war ein wunderschönes Leben, der Himmel auf Erden, allerdings von zuhause hatte ich noch keine Nachricht, was mich beunruhigte.
Im Sommer 1946 wurde ich entlassen, und als ich nach Hause kam und meinem Vater sagte, dass ich jetzt Bildhauer sei, dachte er, ich sei meschugge. Erst als ich nach Kreuznach fuhr und einige meiner Objekte im Kunsthandel verkaufen konnte, hat er eingesehen, dass wohl was dran sei. Ich bekam einen Sonderstatus in der Familie, also, ich war von der Feldarbeit freigestellt und habe zuhause Holz gebildhauert.
Dann las ich in der Zeitung, dass in Mainz die Kunstschule eröffnet wurde. Ich dachte, eigentlich kann ich ja alles, aber so zwei Semester Kunstschule könnten ja auch nicht schaden. Also habe ich mich angemeldet, wurde angenommen und bin dann nach Mainz übergesiedelt. Das war eine total neue Welt, Mainz war ziemlich kaputt, aber schon wieder urban und das kulturelle Leben war sehr lebendig. Das war ja auch das einzige, was frei zu haben war.
Also Konzerte, Theater, das war in. Man ging dahin, so wie man war, mit irgendwelchen abgetragenen Kleidungsstücken, das war völlig egal. Irgendwie waren ja alle Menschen gleich.
Interessant war die Bildhauerklasse an der Kunsthochschule, in die ich kam. Die Kollegen: jeder hatte so sein eigenes Leben und seine eigene Vorstellung von Kunst. Man hat viel voneinander gelernt. Meine Lehrer waren der Müller-Olm und Georg Kölner. Müller-Olm war ein moderner Künstler, für den die Form im Mittelpunkt stand, die er fast bis zur Abstraktion trieb. Das habe ich sehr bewundert.
Müller-Olm war ein progressiver Bildhauer, der bei den Nazis verpönt war und nichts werden konnte, für uns war es der Inbegriff für moderne Kunst, was er machte.
Der Kölner beherrschte das Handwerkliche in der Bildhauerei, vor allen Dingen Steinbearbeitung und Schrift, was mit sehr zugute kam, denn Schrift hat mich von Anfang an interessiert.
Also, das Leben war auf eine bestimmte Weise „einfach“. Man hatte keine sichere Ansicht über die Zukunft; im Raume stand ob wir zum Agrarstaat werden und keine Industrie mehr haben würden. Aber wir haben das nicht so sehr diskutiert. Ich hatte ein unheimlich tolles Lebensgefühl, war froh, dass wir den Krieg überstanden hatten und genoss die große Freiheit, wo man alles durfte und alles konnte. Geld spielte keine Rolle, denn es war ja nichts wert. Man konnte es auch relativ leicht bekommen. Ich hatte großen Erfolg mit meinen Holzobjekten und eigentlich immer Geld.
1947 hat Dr. Busch von der Stadtbibliothek eine Ausstellung in der Stadtbibliothek gemacht: moderne französische Malerei. Das war wie eine Offenbarung, das war etwas, was wir nicht kannten. Wir haben von früh bis spät darüber diskutiert und wir waren wie trockene Schwämme, die das alles aufgesogen haben.
Gelebt hat man ja fast ausschließlich von der Hoower-Speisung, die gab es an dem Haus in der Goethestraße, wo später das Spanische Konsulat eingezogen ist. Das Essen hat man morgens in Kübeln geholt, zum Beispiel Nudeln mit Fleischeinlage, da musste man den ganzen Tag von leben. Außerdem hatte ich noch meine Heimat im Hintergrund, wo ich zum WE immer hinfuhr. Da gab es eine kleine Landwirtschaft, auf jeden Fall lief das alles ganz wunderbar.
Das hörte schlagartig auf, als 1948 die Währungsreform kam. Dann war es schwierig, an Geld zu kommen. Man musste nach irgendwelchen Jobs suchen und es kam mir zugute, dass ich begeistert „Schrift“ gelernt hatte. Ich konnte mich bei einem Steinmetz betätigen und Schrift in Steine meißeln. Und es gab noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Mainzer Weinmarkt, da gab es ein vom Verkehrsverein gestaltetes Zelt, das hieß „Taberna Romana“, da habe ich mit Kollegen Arkarden mit römischen Motiven entworfen und bemalt. In dem Zelt haben Mädchen als Römerinnen gekellnert und ich war schwarz bemalt, in einem Othellokostüm, und hatte einen dicken Knüppel. Ich musste quasi für die Moral sorgen … na ja (RP lacht), es war ganz lustig.
Aber am lukrativsten war es, Fasnachtswagen zu bauen. Wir haben meist 3 Wagen gebaut, pro Wagen bekam man 3000-4000 Mark, so dass also für jeden genug Geld übrig blieb, davon konnte man ja schon fast ein Jahr überstehen. Ich kam also ganz gut über die Runden und es hätte immer so weiter gehen können. Es gab so viel Neues jeden Tag, so viele neue Erfahrungen.
Das Miteinander der 10 Leute in der Klasse lief gut. Die Kritik der Kollegen war wichtig, sie war oft effizienter als die des Lehrers. Wenn die etwas, was man gemacht hatte, mit süffisantem Lächeln betrachten, war das sehr wirkungsvoll. Jedenfalls wurde ich von Tag zu Tag bescheidener. In der Klasse von Müller-Olm habe ich begriffen, worum es überhaupt geht. Bei der Plastik ist das die Form. Die Form ist die Grammatik der Plastik. Sowie die Sprache Grammatik braucht, sonst wäre sie nur Gestammel. Erst eine gute Form erhebt ein Objekt in eine gewisse Zeitunabhängigkeit. Wenn man die Geschichte der Kunst betrachtet, haben die Ägypter Stil geprägt, aber auch andere natürlich. Und durch die Entwicklung von Stilen konnte man Meister unterscheiden. ZB war festgelegt, wie eine Madonna zu stehen hatte. Man ist heute natürlich viel freier, aber im Prinzip gelten auch heute noch die gleichen Regeln und das wird wahrscheinlich auch wohl so bleiben.
1949 kam Emy Roeder ans Institut. Emy Roeder gehörte zu den Brückeleuten mit Rottloff und Heckel und Purmann und Kirchner Sie war vor dem Krieg nach Italien emigriert und hat da den Krieg überlebt. Was sie gemacht hat, das fand ich ganz besonders und das hat mir sehr gut gefallen – und ihr gefiel auch was ich machte. Und so wurde ich bei ihr Assistent und Meisterschüler. Wir haben dann zusammen auch größere Objekte gemacht. Eine große Plastik ist ja schon schwere körperliche Arbeit und sie war eine zierliche alte Dame. Das konnte sie körperlich gar nicht schaffen. Solche Objekte habe ich für sie aufgebaut. Das war eine sehr interessante Zusammenarbeit, bei der ich viel gelernt habe. Ich habe zwar manches anders gemacht, aber mich schon nach ihr gerichtet. Sie hat bestimmt, wie etwas werden sollte.
Emy Roeder machte damals auch viele Kleinplastiken, unter anderem auch eine, das war ganz lustig, ein Portrait von dem Maler Schmitt-Rottloff, der ja auch zu der Gruppe der Brückeleute gehörte, und der im Sommer immer im Hof der Galeristin Bekka von Raths wohnte am Börsenplatz in Frankfurt. Der kam jeden Tag rüber nach Mainz und die Emy hat ihn portraitiert. Das war aber nicht ganz einfach, denn sie war nie damit zufrieden, weil er wie der Bulganin aussah, der russische Ministerpräsident. Was sie auch machte, der Schmitt Rottloff sah eben aus wie der Bulganin. Ich habe ihr dann geraten, sie solle ihm eine Baskenmütze aufsetzen, das brachte einen ganz neuen Touch ein und damit sah er dann wohl auch so aus, wie Emy sich das gewünscht hatte. Es war eine fantastische Zeit mit ihr.
Dann lernte ich meine Frau kennen, und wir wollte heiraten. Die erste Frage meiner Schwiegermutter war: „Und von was wollen Sie Ihre Frau ernähren?“ Das wusste ich natürlich nicht. Und ich hatte auch keine Ahnung, was ich darauf sagen sollte. Da kam eines Tages Emy Roeder und sagte: Der Professor Vollbach, den sie in Italien kennengelernt und mit dem sie sich angefreundet hatte, der war jetzt Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmuseum. Der sucht jemand, der restaurieren und Repliken machen konnte. Emy meinte, ich sei versiert und kann das doch machen. Ich wollte mich aber nicht irgendwo den ganzen Tag verdingen, sondern hatte schon die Idee von einem freien Künstlerleben – wie so allgemein das Bild von Künstlern ist. Aber dann dachte ich, halbtags könnte ich es probieren. Ich ging also zu ihm und es war ganz anders, als ich mir das vorher gedacht habe. Es erwies sich als sehr interessant, ich bekam interessante Objekte und es war wie eine Idylle: es gab keinen Arbeitsdruck, man konnte frei vor sich hin probieren.
Ich habe dann noch den Kollegen Hilmar Stauder mit reingebracht und die Lucia Schmitz und wir haben die Werkstatt richtig aufgemischt. In den 1950 Jahren kamen die neuen Werkstoffe auf, die ganz neue Möglichkeiten boten, gerade auch was die Repliken betraf. Vorher gab es ja eigentlich nur Gips, der ist für die Herstellung von Plastiken gut, aber Gips hat seine Grenzen. Der Anspruch war, naturgetreue Repliken zu machen, und mit den neuen Kunststoffen konnte man das sehr gut. Man konnte die Kunststoffe transparent machen, oder elfenbeinartig, oder in Metall-look. Das war für das Museum wichtig, aber auch für die Bildhauerei. Ich habe dann auch meine Plastiken nach diesen Verfahren und mit diesen Werkstoffen gestaltet. Eines Tages kam Prof. König vom Institut für Kunst- und Werkerziehung der Uni auf mich zu und fragte, ob ich nicht an sein Institut kommen wollte, um diese Technik bei ihm weiterzuentwickeln. Ich bin dann probehalber 5 Stunden am Samstag dort gewesen. Dann habe ich noch zweimal 2 Stunden Aktzeichnen abends gemacht. Ich habe aber gemerkt, dort als Lehrer aufzutreten, das war ungleich anstrengender als mein Museumsleben. Wenn ich dann samstags nach Hause kam, war ich zu nichts mehr in der Lage, wenn ich aber vom Museum nach Hause kam, war ich topfit und konnte noch meinen Arbeitsinteressen nachgehen.
Damals war es so, dass es mit dem Wiederaufbau von RP auch Wettbewerbe für Kunstobjekte gab, von denen ich viele gewonnen habe. Das waren teilweise große Objekte, die ich da gestalten musste, das hätte ich mit der Uni gar nicht machen können. Das sprach für das Museum.
Ich war ja nun verheiratet und meine Frau arbeitete als Ärztin. Als dann meine Tochter zur Welt kam, blieb sie zuhause. Meine Frau war für mich ganz wichtig. Ohne meine Frau wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Sie hatte einen Sinn für das Praktische und wusste, was Sache war, während ich wahrscheinlich eher in einem Wolken-kuckucksheim schwebte. Ich habe dann auch Lebensversicherungen und so was abgeschlossen, wofür ich ja sonst gar keinen Sinn gehabt hätte. Sie bildete den Stil der Familie, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe. Die Familie war und ist mir sehr wichtig, wir haben 3 Enkel und jetzt eine Urenkelin … das ist der Halt, der für mich den Sinn des Lebens ausmacht. Meine Frau ist letztes Jahr gestorben, meine Tochter hat quasi ihre Rolle übernommen und ist sehr fürsorglich für mich – das ist ein großes Glück.
Die Familie war der Rahmen, aus dem heraus ich gestalten konnte. Ich war natürlich in erster Linie bemüht, Plastiken zu machen. Das war meine große Leidenschaft. Ich finde, Leidenschaft ist überhaupt das Wichtigste. Begabt sind viele, aber Begabung ist nicht das Wesentliche. Die Leidenschaft für eine Sache ist viel wichtiger, so dass manchmal die Unbegabten, die leidenschaftlich sind, bessere Leistungen erzielen, weil für sie immer alles abenteuerlich bleibt. Ich hatte glücklicherweise etwas von Beidem. Eine Plastik aufzubauen, das ging mir gut von der Hand. Auch wenn ich manchmal dachte, daraus wird nichts. Aber man muss das mögliche Scheitern einkalkulieren.
Von den meisten meiner Plastiken gibt es zwei Versionen. Die erste Version entsteht beim Anlegen einer solchen Plastik. Man macht eine Metallkonstruktion und nimmt dann Gips, später war das Polyesterharz und Talkum, also ein Material, das neutral war und keine eigene Schönheit hatte. Was in Gips gut war, ist in anderem Material gut oder noch besser. Man sieht im Gips jeden Fehler. Jedenfalls habe ich diese Qualität später auch mit Polyesterharz erreicht. Es gibt also eine Phase, wo das Gebilde, das ich vorhatte zu erschaffen, noch ganz abenteuerlich aussah. Es gab tiefe Einbrüche und sehr stark strukturierte Oberflächen. Das hat mich immer so fasziniert, dass ich mir davon einen Zwischenabguss machte. Dann habe ich an dem Objekt weiter gearbeitet, denn mein eigentliches Bestreben war ja, das Ganze durchzugestalten, um die sinnliche Qualität eines Körpers sichtbar zu machen, also zum Beispiel wo ein Muskel spannt, oder wo die Brust weich ist – das ergibt sich allein aus der Gestaltung der Fläche. Die Spannung an der Fläche bestimmt auch die Qualität des Objektes. Das war also schon mein Endziel, aber ich habe mich auch gefragt, warum mir das erste, eigentlich unfertige Objekt so gut gefiel. Ich kam dann darauf, dass es einfach das Morbide war, ja, das was eine Ruine ausmacht wie die Akropolis, die unser Auge anzieht.
Es kamen auch Aufträge für Großplastiken, die man nicht auf dieselbe Weise herstellen konnte wie die kleinen Objekte, sondern wo man gegen Architektur anklotzen musste. Dazu habe ich abstrakte Formen entwickelt. Meine erfolgreichste Plastik bestand aus einem System von Vierkantröhren. Ich hatte einen ganzen Baukasten aus Krümlingen und geraden Stücken, die ich kombinieren konnte. Es war für mich selbst erstaunlich, was man aus solchen, eigentlich unansehnlichen Einzelstücken für phantastische Gebilde machen konnte. Ich habe einige Wettbewerbe gewonnen, daher gibt es viele Großplastiken von mir im öffentlichen Raum.
Ich habe auch noch andere Arten von Plastiken entwickelt, zum Beispiel eine, die nur aus Strukturen bestand, so wie die Zwischenabgüsse der Plastiken, wie ich es vorhin geschildert habe. Das waren jetzt Strukturen, die entstanden durch die Eigenschaften von Polyacryl, was auch in nasser Umgebung aushärtet. Das waren aber alles Unikate – und wenn die verkauft waren, waren sie weg. Ich habe davon nur noch drei und die drei hüte ich wie einen Augapfel.
Es gab auch eine Phase, in der ich Edelstahl bearbeitet habe. Den Stahl habe ich mir auf dem Schrottplatz geholt. Meistens irgendwelche Reste, aus denen ich ganz interessante Objekte gemacht habe. Manche haben mich gefragt, wie ich dazu käme, wo ich doch sonst ganz andere Dinge gemacht hätte. Aber ich finde, der Mensch ist ein vielseitiges Wesen. Außer Gegenständen gibt es ja auch Zustände und Stimmungen. Das ist ganz selbstverständlich in der Musik und der Literatur. Die bildende Kunst tat sich schwer, so etwas auszudrücken. Dazu gibt es eben die abstrakten Formen, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Deshalb habe ich auch gerne abstrakte Objekte gemacht.
Und weil ich unabhängig war durch die Arbeit am Museum, konnte mir auch egal sein, was andere darüber gedacht haben. Ich habe immer das gemacht, was mir gefiel. Ich war insofern ein richtig freier Mensch.
Zum Schluss: es gibt noch eine Eigenart, die meine weiblichen Figuren betrifft. Die stehen oft, obwohl sie völlig nackt sind, auf Stöckelschuhen – neudeutsch: high-heels. Mmh, ja. Darauf bin ich gekommen als Aktzeichenlehrer. Aktzeichnen ist ja leider nicht das, was die meisten denken, das es wäre. Man geht zwar dahin mit Herzklopfen und denkt, das steht jetzt eine nackte Frau, die kann man ungeniert betrachten, aber nach 10 Minuten ist das die langweiligste Übung, vor der man sich im Institut am liebsten gedrückt hätte, weil keiner genau wusste, um was es eigentlich ging. Wenn man das einmal weiß, dann wird es interessant. Es geht nämlich um gar keinen Fall darum, sie einfach abzuzeichnen. Das ist der Tod und macht die Sache langweilig. Nein, man muss die Ordnung dieser Figur erkennen und diese in die eigene Ordnung übersetzen, das heißt, man muss etwas Adäquates machen, zu dem was da steht. Dann wird es spannend. Aktzeichnen war mit meine große Leidenschaft, die ich heute noch betreibe. Ich habe immer noch einen Aktzeichenkurs und es ist unglaublich, zu welchen Ergebnissen selbst unerfahrene Leute kommen können, wenn sie die Leidenschaft antreibt.
Ja, jetzt am Ende meines Lebens, wenn ich zurückblicke und wenn ich sehe, was ich alles gemacht habe, wundere ich mich manchmal über mich selbst. Wie alles gekommen ist und was möglich war – darüber bin ich glücklich und ich empfinde mich manchmal sehr privilegiert.
Ich habe ja auch Gedichte geschrieben und bei einem ist der letzte Vers:
„Wenn ich sehe, was ich vollbracht,
kommt mir manchmal in den Sinn,
ob für den, der sowas macht,
ich der richtige Umgang bin.
Reinhold Petermann
zum 10.10. 2015